Last Update: 14.03.2025 // Update "Schallplatte" und "Streaming " (BVMI-Reports zu 2024)
Ⓢ

Audio:
Die "Super Audio Compact Disc"/"SA-CD" war eine gemeinsame Entwicklung von Sony und Phillips und eigentlich als Nachfolger der Compact Disc (CD) gedacht. Der Unterschied zur CD besteht in einer höheren Speicherkapazität und in der höheren Auflösung des digitalen Audiosignals. Die "normale" CD hat ca. 700 Mbyte und arbeitet mit 16 Bit bei 44,1 kHz Sampling. Die "SACD" hat eine Speicherkapazität von 470-850 Mbyte und arbeitet mit einem 1 Bit Bit-Stream von 2,822 MHz (entspricht 64 Bit bei 44,1 kHz). Ferner kann die "SACD" mehrere Audiokanäle (Surround-Klang) wiedergeben. Das SACD-Format findet auch bei der DVD Anwendung. Die "SACD" werden meist mit der Bezeichnung "Hybrid-SACD" angeboten, da hier beide CD-Formate (Standard CD und "SACD") integriert sind.
Auf dem Portal discogs.com sind übrigens über 14.600 SA-CDs registriert (Stand 02/2025); klick HIER.
Hinweis: ältere CD-Player können u.U. kein SACD/SA-CD-Format abspielen.
Beispiel einer Hybrid-SACD: "LENNY KRAVITZ - GREATEST HITS" (klick HIER)
Weitere Infos und Details zur "SACD" gibt es auf Wikipedia: Super_Audio_Compact_Disc; s. dz. auch "CD", "SBM", "UHCD", "CD-Player"
-----------
(← Top )

Lautsprecher:
Bei einem Lautsprecher-Set (z.B. eine 2.1 Lautsprecher-Kombination) bestehend aus zwei Lautsprecherboxen (Stereo links & rechts) und einem Subwoofer, da bezeichnet man die beiden Lautsprecher als "Satelliten".
"Satelliten-Lautsprecher" können beispielsweise kleine Regalboxen sein aber es können durchaus Kompaktboxen, ebenfalls Monitore oder auch große Standboxen sein.
-----------
(← Top )

Audio:
"Super Bit Mapping" ist ein von SONY entwickeltes "Rauschumformungsverfahren". Der Super Bit Mapping-Prozess wandelt ein 20-Bit-Audio-Signal der Master-Aufnahme rauschfrei in ein 16-Bit-Signal nahezu ohne Verlust der Tonqualität. Dabei wird ein Rauschformungsverfahren verwendet, um das Signal-Rausch-Verhältnis in denjenigen Frequenzbereichen zu verbessern, die das menschliche Gehör am deutlichsten wahrnimmt.
Beispiel einer "CD" die mit dem SMB-Verfahren produziert wurde:
"Dire Straits - Brother in Arms"; klick HIER).
Weitere Informationen gibt es auf Wikipedia: SMB und Rauschverformung; s. auch "CD", "SACD", "UHQCD", "CD-Player"
-----------
(← Top )

Audio/Video:
SCART ist eine Steckverbindung zur Übertragung von analogen Audio und Video-Signalen und wurde nur in Europa verwendet. Eingeführt wurde diese Steckverbindung um Video-Recorder mit dem TV-Fernseher zu verbinden. Das Kabel hatte an jedem Ende einen Stecker und die Geräte (TV und Videorekorder) hatten die passende SCART-Buchse.
Mit dem Aufkommen der digitalen Übertragung wurde kurz nach der Jahrtausendwende die SCART-Verbindung wurde durch den HDMI-Standard (s. dz. "HDMI") abgelöst;
mehr Infos und Details zur SCART-Verbindung gibt es auf Wikipedia: SCART.
-----------
(← Top )

Akustik:
Die Töne, Geräusche und Klang, die der Lautsprecher (s. dz. "Schallwandler") aus dem Audiosignal erzeugt, sind physikalisch betrachtet nichts anders als sich ausbreitende und schwingende Schallwellen. Schallwellen wiederum sind Luftverdichtungen (Druckwellen in unterschiedlicher Stärke und Dichte) die durch eine Schallquelle (z.B. Stimmbänder, Lautsprecher, Instrument, Umweltgeräusche ...) erzeugt werden. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit beträgt 343 m/s (= 1236 km/h) bei trockener Luft und 20℃ Lufttemperatur.
Die Lautstärke wird durch den Schalldruck wahrgenommen. Der Schalldruck wird mit der Maßeinheit Dezibel [dB] gemessen (früher auch mit der Einheit "Phon").
Zur Einordung: die menschliche Hörschwelle liegt bei ca. 0 dB und die Schmerzgrenze liegt etwa bei 120-130 dB.
Weitere Informationen zum Schall gibt es auf Wikipedia: Schall, Schallgeschwindigkeit, Schalldruck, Bel/Dezibel, Phon;
s. dz. auch "Dezibel", "Lautstärke".
-----------
(← Top )

Akustik:
Um Schall-Reflektionen zu minimieren, verwendet man schall-absorbierende Bauelemente mit entsprechend hohen Schall-Absorptionsgrad. Neben dem Schallabsorber gibt es u.a. auch die Akustikpaneele, Schaumstoffmatten, 3-D Strukturen oder geschlitzte Rahmen-Elemente (s. Foto) etc. Hilfreich zur Verbesserung der Akustik sind auch Gardinen, Teppiche und die Verwendung schallabsorbierender Deckenelemente.
Auch sogenannte Bass-Traps (s.u.) sind Absorber und sollten ggf. bei der Verwendung von Subwoofer (s. dz. "Subwoofer") verwendet werden.
Schallabsorber, wie auch andere schallabsorbierende Elemente, (s.o.) findet man beispielsweise in Tonstudios oder auch in guten HiFi-Studios.
Weitere Infos dazu auf Wikipedia: klick Breitbandabsorber oder im Begriff "Akustik".
-----------
(← Top )

Akustik:
Die Lautstärke wird durch den "Schalldruck" im menschlichen Ohr wahrgenommen. Der "Schalldruck" wird durch die Maßeinheit Dezibel [dB] gemessen (früher auch mit der Einheit "Phon").
Die menschliche Hörschwelle liegt bei 0 dB und die Schmerzgrenze liegt etwa bei 120-130 dB.
Bei Lautsprecher-Boxen versucht man einen möglichst linearen Schalldruck über dem gesamten Frequenzspektrum erreichen. Leichte Abweichungen ergeben dann eine spezifische Klang-Charakteristik. Grundsätzlich ist es eigentlich so, dass jede Lautsprecher-Box einen eigenen (spezifischen) Klang besitzt (vgl. dz. Klang-Dynamik und Lautsprecher-Wirkungsgrad)
Weitere Informationen: s. dz. "Schall", "Dezibel", "Lautstärke" , "Phon"
-----------
(← Top )

Audio:
Die "Schallplatte" ist ein analoger Tonträger aus PVC (Polyvinylchlorid), in der Kurzform einfach nur mit "Vinyl" bezeichnet.
Die Toninformationen der "Schallplatte" ist mechanisch in einer spiralförmigen Rille eingepresst. Die Rille wurde zuvor v-förmig mit einem Stichel in eine Schablone (Matrize) geschnitten und mit Abzügen von dieser Master-Matrize werden die Schallplatten in einem
Presswerk hergestellt.
Die beiden Flanken der modernen Mikrorille haben mikroskopisch kleine Wellen, Berge und Täler, man nennt das die "Plattenschrift" oder "Flankenschrift".
Zum Abspielen wird die Schallplatte auf den Teller des Plattenspielers (s. dz. "Plattenspieler") gelegt und in Rotation gebracht. Mit dem Aufsetzen des Tonarms, respektive des Tonabnehmers, ertastet ("liest") die Abtastnadel die mechanischen "Informationen" der Flankenschrift. Bei diesem Vorgang wird die Abtastnadel in Vibration versetzt. Diese Vibrationen werden über den Nadelträger in den Tonabnehmer übertragen und erzeugen (induzieren) dort ein analoges (elektrisches) Wechselsignal. Dieses Signal ist bereits das Audiosignal, das die Toninformationen der Schallplatte beinhaltet.
Damit das Audiosignal im Verstärker der Musikanlage wiedergegeben werden kann (und daraus Schall erzeugt werden kann), muss das Audiosignal des Tonabnehmers zuerst noch in einem Phono-Vorverstärker linearisiert und etwas verstärkt werden (mehr Hintergrundinformationen dazu sind in den Begriffen "Entzerr-Vorverstärker" oder "RIAA-Kurve" beschrieben.
Pressebericht des BVMI vom 20.02.2025 zur Entwicklung in 2024:
die Vinyl-Schallplatte konnte in 2024 um 9,4% zulegen (Anteil 6,4% am Gesamtumsatz), bleibt aber weiterhin hinter der CD
mit 8,7% Anteil am Gesamtumsatz (Streaming hat 84,1%) klick HIER
Tipp:
In meinem "Platten-Lexikon" (klick HIER) und in meinem Schallplatten-Kompendium "Abkürzungen & Fachbegriffe" (klick HIER) findet man viele weitere Informationen und Erklärungen zur Schallplatte.
Weitere Informationen zur Schallplatte:
- Eine sehr schöne Grafik zur Schallplatten-Herstellung der Stuttgarter Zeitung (03/2023) gibt es HIER
- auf Wikipedia: Schallplatte
- Lexikon-Begriff: "Ultraschall-Reinigungsgeräte" und "Schallplattenwaschmaschine"
-----------
(← Top )
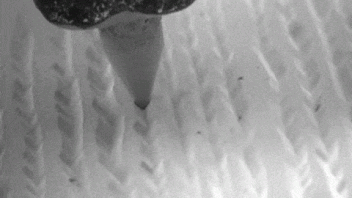
Audio:
Ein Vinyl-Schallplatte hat nicht viele "Rillen", wie allgemein angenommen, sondern lediglich eine "Rille" auf jeder seite der Schallplatten. Die "Rille" (Tonrille) ist spiralförmig in der Vinyl gepresst worden. Die "Rille" ist mikroskopisch betrachtet v-förmig und beinhaltet die Ton-Information in Form einer welligen Flächenstruktur in den Flanken der V-Form. Daher heißt im Fachjargon dieser "Tonspeicher" die "Plattenschrift" oder "Flankenschrift".
Technischer Aufbau
Die heutige, standardisierte Stereo-Mikrorille hat an der Oberfläche eine Breite von ca. 40 µm und am Rillenboden eine Verrundung (Radius) von ca.8 µm. Die beiden Flanken der v-förmigen "Rille", haben einen Neigungswinkel von 45° (daher hat diese Rillentechnik das Kürzel "45/45") und stehen somit eine einem Winkel von 90 Winkelgraden zueinander. Das technische Meisterwerk ist hierbei, dass es gelungen ist, die beiden Stereokanäle in eine "Rille" zu integrieren (modulieren), respektive einzuschneiden. Mit der Einführung der Quadrophonie hat man es sogar geschafft 4 Kanäle in die Rille zu modulieren!
Die frühere Mono-Rille hatte eine Breite von ca. 55 µm und einen Rillengrundradius von 10 µm. Im gegen Satz zu Stereo-Rille wurde die Toninformation der Mono-Rille rein durch seitliche Auslenkungen (lateral) in das Vinyl geschnitten.
Ich habe mal ausgerechnet, wie lang in etwa eine "Rille" sein kann. Wird eine Seite einer Langspielplatte (LP) komplett abgespielt, dann hat eine Abtastnadel (je nach Spieldauer) in etwa eine Strecke von ca. 300-500 Meter zurückgelegt (ich selbst hab' mal ausgerechnet, dass bei einer angenommen Spieldauer von 20 Minuten bei 33 1/3 U/Min. die "Rille" eine Länge von ca. 460,5 Meter hat). Berücksichtigt man dann noch die zweite Seite, so kommt man in Summe auf die Stecke von 600-1000 Meter, was ja dann schon im Bereich eines halben bis eines ganzen Kilometers liegt!!!
Abspielvorgang (siehe Animation)
Eine "Schallplatte" rotiert beim Abspielen auf einem "Plattenspieler" und dabei wird die "Rille" (die Flankenschrift) mit einem "Tonabnehmer", genauer gesagt mit der "Abtastnadel" des "Tonabnehmers", abgetastet (ausgelesen). Die dabei entstehenden mechanische Bewegung wird im "Tonabnehmer" in ein elektrisches "Audiosignal" umgewandelt. Das "Audiosignal" hat nur wenige mV und muss deshalb in einem "Phono-Vorverstärker" linearisiert und verstärkt werden.
Weitere Informationen:
- s. dz. "Schallplatte", "Abtastnadel", "Tonabnehmer", "Audiosignal", "Plattenspieler", "Phono-Vorverstärker"
-----------
(← Top )

Plattenwaschmaschinen sind mittlerweile sehr verbreitet, nicht nur in den Schallplattenläden, sondern auch bei vielen Plattensammlern. Im Gegensatz zur CD muss eine Schallplatte ab und zu (eher selten) gereinigt werden. Dies liegt am Material und an der Mikrorille der Schallplatte. Das Vinyl lädt sich elektrostatisch auf und bindet dadurch Staubpartikel.
Man kann Schallplatten manuell reinigen aber ambitionierte Plattensammler verwenden dazu lieber eine Plattenwaschmaschine, da diese Art der Reinigung viele gründlicher ist.
Marktüberblick zu Schallplattenwaschmaschinen:
a) mechanisch arbeitende Reinigungsgeräte
b) auf ultraschallbasierende Reinigungsgeräte
Weitere Infos: s. dz. die Lexikon-Begriffe "Schallplatte", "Plattenspieler", "Ultraschall", "Phono-Vorverstärker"
-----------
(← Top )

Lautsprecher:
Die Lautsprecher-Schallwand variiert in der Größe, Form und Anordnung der Lautsprecher-Chassis.
Angefangen von kleinen 1-/2-Wege-Regallautsprechern und reicht bis hin zu großen, meterhohen Standboliden. Bei den Lautsprecher-Boxen sind die geschlossen Gehäuse sehr verbreitet aber es gibt auch Schallwände, die rückseitig komplett offen sind, das sind die sogenannten "Open Baffle Speaker" (dt. "offene Lautsprecher-Schallwand");
Mehr Informationen zu den unterschiedlichen Bauformen von Lautsprecher-Boxen gibt es in meinen Vinyl-Ratgeber "Schallplatten hören" im Abschnitt Lautsprecher, klick HIER; vgl. dz. auch "Lautsprecher", "Lautsprecher-Typen", "Lautsprecher-Chassis"
-----------
(← Top )

Lautsprecher:
Ein Lautsprecher ist ein "Schallwandler", das ist die eigentliche Bezeichnung für eine Lautsprecher.
Ein Lautsprecher erzeugt elektromagnetisch aus einem Audiosignal Schwingungen in der Luft, das ist der Schall. Das Audiosignal wird durch ein bewegliches Spulensystem in einem Magnetfeld geleitet. Die daraus resultierende mechanische Schwingung der Spule wird auf eine Fläche (Membran, Folie, Kalotte) übertragen. Die daraus pulsierenden Luftschwingungen, es sind Verdichtungen und Entspannungen von Luft, erzeugen den hörbaren Schall;
mehr Informationen zu den unterschiedlichen Typen und Bauformen von Lautsprechern gibt es in meinen Vinyl-Ratgeber "Schallplatten hören" im Abschnitt Lautsprecher, klick HIER; vgl. dz. auch "Lautsprecher-Chassis", "Lautsprecher", "Lautsprecher-Typen" und auf Wikipedia: Lautsprecher.
-----------
(← Top )

Audio:
Im HiFi-Audio-Bereich wird das Schrägspurverfahren im "DAT-Rekorder" (DAT=Digital Audio Tape") verwendet. Die Schrägspurtechnik ist die gleiche Technik wie beim VHS-Rekorder. Beim "DAT-Rekorder" verwendet man ein "Magnetband" das sich in einer Kassette befindet, das ist die "DAT-Kassette". Die Bauform der "DAT-Kassette" ähnelt stark der "Kompaktkassette", ist aber etwas kleiner, sodass die Kassetten zueinander nicht kompatibel sind.
Im "Schrägspurverfahren" wird das "Audiosignal" digital auf das "Magnetband" geschrieben. Im Gegensatz zum "Tonbandgerät" oder dem "Kassettenrekorder", wird hier das "Magnetband" an einer rotierenden Tonkopftrommel verbeigezogen, wobei die Tonkopftrommel aus mehren Tonkopfscheiben besteht. Das besondere hierbei ist, dass die Tonkopftrommel schräg, im Winkel von 20° rotiert und dadurch längere Signalspuren auf das Band schreibt als das Magnetband breit ist. Diese Technik, in Verbindung mit den rotierenden Tonköpfen, ermöglicht die benötigte digitale Datenmenge auf das "Magnetband" zu schreiben.
Die Rotationsgeschwindigkeit der Tonkopftrommel liegt bei 2000 U/Min.! Die Geschwindigkeit, mit der das Magnetband an der Tonkopftrommel vorbeigezogen wird beträgt lediglich 0,815 cm/s. Das ist deutlich langsamer als die Bandgeschwindigkeit einer Kompaktkassette, die bei 4,75 cm/s liegt. Somit passen z.B. 120 (digitale) Audio-Minuten auf eine DAT-Magnetbandlänge von nur 60 Metern.
Vorteil: Hohe Datendichte auf dem Magnet, relativ kurze Bandlängen, kein Bandrauschen,
Nachteil: mechanische Belastung des Magnetbands; bei Gerätewechsel kann es passieren, dass die DAT-Kassette nicht gelesen werden kann, denn die Position der Tonkopftrommel muss sehr genau justiert sein.
Weiterführende Informationen:
- s. dz. "DAT-Kassette", "DAT-Rekorder"
- auf Wikipedia: Schrägspuraufzeichnung
-----------
(← Top )

Audio:
Das "Signal" in diesem Kontext, eigentlich das "Audiosignal", überträgt den hörbaren Ton in Form einer elektronischen Wechselspannung (ca. 16-20 KHz bei 1 Volt) von einer Tonquelle über Verbindungen (Kabel, Glasfaser, Funk) zum Verstärker und dann bis hin zu den Lautsprechern, wo das ursprüngliche Eingangssignal in Schall umgewandelt wird. Je nach Soundtechnik sind es mehrere Signale (z.B. bei stereo: linker und rechter Kanal).
Hier mal beispielhaft eine komplette Signalübertragungskette:
Signalquelle (z.B. Tuner, Streamer, CD-Player, Plattenspieler) → Verstärkereinheit (z.B. Vollverstärker, Receiver, Vor- und Endstufe) → Lautsprecher-Box/Kopfhörer
Mehr Infos zum "Audiosignal" gibt es auf Wikipedia: Audiosignal, Audio
-----------
(← Top )

HiFi:
Die "Signalquelle" oder "Audio-Signalquelle" war früher neben dem Radio immer ein physischer Tonträger (z.B. ein Tonband, die Schallpatte, eine Diskette, die MiniDisc oder eine CD).
Heutzutage werden diese Tonträger-Typen mehr und mehr durch das digitale Streamen aus dem Internet verdrängt, sie werden ein Nischenprodukt. So ist in den Jahresreports des "Bundesverband Musikindustrie" (BVMI, klick HIER) nachzulesen, wie ab 2012 der Musikkonsum über das Streamen rasant angestiegen ist: Marktanteile Stand 2023: 81,5% digital / 18,5% physisch (Quelle BVMI-Report 2023).
In der heutigen Zeit sind folgende Signalquellen in der heimischen Musikanlage denkbar, zumindest teilweise vorhanden: Streaming, Compact Disc (CD), Schallplatte, Kassette, DAT-Kassette, MiniDisc (MD), Tonband, Tuner.
Hintergrund-Info:
- s. dz. "Musikanlage"
-----------
(← Top )

Audio:
Der Signalrauschabstand wird oftmals mit SNR ("Signal Noise Ratio") abgekürzt. Der Signalrauschabstand sagt etwas über die Klangqualität aus und zwar wie groß das Verhältnis zwischen dem Nutzsignal (Audiosignal) und des Störsignalpegel ist (z.B. verursacht durch das Systemverhalten wie Rumpeln, Brummen, Grundrauschen der Elektronik).
Weitere Informationen:
Einen sehr informativen Artikel darüber gibt es beim Portal von "fairaudio": klick HIER
Details auf Wikipedia: Signalrauschverhältnis.
-----------
(← Top )

Plattenspieler:
"Shibata" ist der Name für eine besondere geometrische Form einer geschliffenen Nadelspitze. Diese Nadel sitzt sehr genau (mit relativ hoher Auflagefläche) in der Schallplattenrille und ist in der Lage feinste Rillennuancen abzutasten.
Ursprünglich wurde dieser Nadelschliff entwickelt um Quadrofonie-Schallplatten abzutasten, denn die 3. und 4. Tonspur befindet sich im modulierten (nicht hörbaren) Frequenzbereich von 30 kHz -60 kHz (s. dz."Quadrofonie") und erforderte eine sehr exakte Abtastung durch die Nadelspitze.
Abtastnadeln mit einem "Shibata"-Schliff sind meist bei hochpreisigen Tonabnehmer vorzufinden.
Beispiel eines Tonabnehmers (Einsteiger-Model AT-VM95SH) mit einer Shibata-Nadel (Blog von mir aus 08-2022): klick HIER.
-----------
(← Top )

HiFi:
Die meisten digitalen Abspielgeräte, wie z.B. CD-Player oder DAT-Rekorder, sind mit "Skip-Tasten" (vorwärts "->>" und "<<-" rückwärts) ausgestattet. Bei Betätigung dieser Tasten springt der Player, je nach gedrückter Richtungstaste, entweder vor zum nächsten Titel oder zurück zum Titelanfang (um zum vorherigen Titel zu kommen muss man 2x die Rückwärtstaste betätigen).
Bei den Abspielgeräten für analoge Tonträger (z.B. Plattenspieler, Kassetten-Rekorder oder Tonbandgerät) gibt es die Skip-Funktion nicht, denn sie haben keinen Index (Inhaltsverzeichnis/Sprungmarken zu den Titelspuren).
-----------
(← Top )

Plattenspieler:
Viele Tonarme habe einen sogenannten SME-Anschluss. Es ist nicht anderes als ein Bajonett-Anschluss, der ursprünglich vom der englischen Tonarm- und Plattenspieler-Hersteller SME für die Tonarm-/Headshell-Verbindung eingeführt wurde. Daher auch die Bezeichnung SME (SME=Scale Model Equipment).
Der SME-Anschluss hat 4 Verbindungspins über die die beiden Stereo-Signale (jeweils Plus und Minus) an die Tonarmverkabelung weitergeleitet werden.
Der Vorteile dieser mechanischen Verbindungstechnik ist das schnelle Auswechseln von Tonabnehmer ohne das man dazu Werkzeuge braucht. Das ist sehr praktisch für HIFi-Liebhaber, die unterschiedliche Tonabnehmer benutzen.
Es gibt Hersteller (z.B. ORTOFON) die Tonabnehmer-Modelle anbieten, bei denen der SME-Verbindungsstecker fest mit dem Tonabnehmer verbunden ist, d.h. man benötigt keine zusätzliche Headshell.
Weitere Informationen:
- s. dz. "Headshell", "Tonabnehmer", "Tonarm", "Plattenspieler"
- Wikipedia: SME-Tonarm
-----------
(← Top )

Audio:
Als die PCs (zunächst Tower- und später Desktop-Systeme) aufkamen gab es extra Soundkarten zum zusätzlichen Einbau mit denen die digitalen Musikdateien in ein analoges Audiosignal umgewandelt werden. Umgekehrt geht aber auch, man kann mit Soundkarten auch ein analoges Audiosignal digitalisieren, z.B. die Musik von einem Plattenspieler in eine MP3- oder FLAC-Datei umwandeln (vgl. dz. meinen Artikel über das Digitalisieren von Schallplatten, klick HIER).
Heutzutage, im Zeitalter der Laptops, kann man über die USB-Schnittstelle externe Soundkarten anschließen. Dies macht dann Sinn, wenn beispielsweise die Soundkarte im Laptop eine schlechte Soundqualität besitzt.
-----------
(← Top )

Lautsprecher:
Bei Lautsprecher-Boxen oder speziell beim Subwoofer, können sich Gehäuseschwingungen auf den Boden übertragen und zum Dröhnen führen. Daher gibt es zur Entkopplung im Zubehörhandel "Absorberfüße" oder besser noch "Spikes".
Spikes" sind runde, spitz laufende Zylinder, die am Boxenboden angeschraubt werden.
Tipp:
Bei Teppichboden oder Holzboden empfiehlt es sich, die Spikespitzen auf Metallscheiben oder Holzplättchen zu stellen, sonst gibt es
unweigerlich Löcher im Boden.
-----------
(← Top )

Elektrotechnik:
Wickelt man Draht oder eine dünne Folie zu einem Bund dann hat man eine Spule (das nennt man auch Wicklung oder Coil).
Leitet man Wechselstrom durch eine Spule, dann wird dadurch ein Magnetfeld im Bereich der Wicklung induziert (s. Wikipedia: Induktivität).
Spulen werden durch ihren ohmschen Widerstand und durch ihre Induktivität (Henry (mH)) klassifiziert.
Spulen beeinflussen das Verhalten von Wechselspannungen durch ihre Induktivität. Beispielweise werden tiefe Frequenzen nahezu unverändert weitergeleitet aber umso höher die Frequenzen werden, umso mehr werden die hohen Frequenzanteile bedämpft (s. dz. Wikipedia: Tiefpass).
Diese physikalische Eigenschaft nutzt man bei dem Bau bei einer "Frequenzweiche" (s. Foto), beim "Lautsprecher-Chassis" oder auch bei der "Klangregelung" in einer Verstärker-Vorstufe.
Frequenzweiche: mit Spulen, Kondensatoren und Widerständen werden Frequenzfilter aufgebaut, sodass man nur bestimmte Frequenzbereiche (Tiefton-, Mittelton-, Hochton-Bereich) an bestimmte "Lautsprecher-Chassis" leitet;
mehr Infos zur Spule und deren Bedeutung in der Elektronik auf Wikipedia: Spule.
-----------
(← Top )

Plattenspieler:
Bei "Plattenspielern" mit einem "Bügeltonarm" wird die Nadelspitze, bedingt durch die feste Position des Tonarmlagers, bogenförmig über die Plattenoberfläche geführt (von oben betrachtet). Während des Abtastens wird dadurch die Nadelspitze in der Rille nach und nach etwas verdreht. Diesen Effekt nennt man den "Spurfehlwinkel". Lediglich an
zwei Stellen in der gamten Rillenfläche ist der "Spurfehlwinkel" = 0° (s. Foto).
Der"Spurfehlwinkel" hat einen Einfluss auf die Präzision der Abtastung und damit auf den Klang! Dies bemerkt man bei sehr guten HiFi-Anlagen in Form von Klangverzerrungen, wenn beispielsweise die Abtastnadel sich in den Bereich des Rillenendes befindet, also kurz vor dem Auslauf im Plattenspiegel.
Um dem Problem des "Spurfehlwinkel" entgegenzuwirken gibt es die Möglichkeit einen sehr langen Tonarm einzusetzen (dadurch wird der "Spurfehlwinkel" etwas verkleinert) oder die Plattenspieler-Konstrukteure verwenden einen "tangentialen Tonarm".
Weitere Infos: s. dz. "Tonarm", "Tangential-Tonarm", "Plattenspieler".
-----------
(← Top )

Plattenspieler:
"SRA" = "Stylus Rake Angle" (zu dt. "Vertikaler Abtastwinkel") ist ein Begriff aus dem Bereich des "Tonabnehmers" und bezeichnet einen Winkel der Abtastnadelspitze zur Schallplattenoberfläche. Bei den meisten Plattenspielermodellen ist der Winkel fest vorgegeben durch die Plattenspieler-Konstruktion. Es gibt aber Plattenspieler, da ist die Tonarmhöhe und damit der "SRA" einstellbar.
Zu beachten ist auch, dass bei der Verwendung von zusätzlichen Plattenteller-Matten sich der SRA verändert.
Mehr Details dazu gibt es in meinem Plattenlexikon im Kapitel "Aufstellung und Justierung" im Abschnitt "VTA/SRA"; klick HIER.
-----------
(← Top )

Der "Standby-Modus" ist ein Stromspar-Modus bei dem bestimmte elektronische Baugruppen abgeschaltet werden, die bei Nichtgebrauch sonst unnötig Strom verbrauchen würden. Moderne Geräte erkennen, wenn das Gerät nicht benutzt wird und über einen Timer schaltet dann das Gerät automatisch in den "Standby-Modus". Diese Funktion gibt es beispielsweise beim Fernseher, beim Laptop und auch bei vielen HiFi-Verstärker und Receivern.
Der Standby-Modus wird am Gerät durch eine leuchtende LED angezeigt und beispielsweise mit einer Fernbedienung kann man das Gerät wieder in den normalen Betriebsmodus schalten.
Viele Geräte, die im normalen Betrieb relativ viel Strom benötigen (z.B. Fernseher oder Receiver), haben einen einstellbaren Timer, der das Gerät bei Nichtbenutzung automatisch in den Standby-Modus schaltet.
-----------
(← Top )

Verbindungstechnik:
Die klassische Verbindung von Audio-Komponenten ist die Verbindung mit Kabeln, meist Kupferlitze (Lautsprecherkabel) oder besondere Koaxialkabel (z.B. RCA/Cinchkabel)
Die Audio-Komponenten haben eine Anschlussbuchse und die Verbindungskabel haben an beiden Enden einen passenden Stecker. Meist ist das eine RCA/Cinch-Verbindung.
Steckverbindungen/Stecker gibt es, neben der bereits o.g. RCA/Cinch-Verbindung, auch noch mit Toslink-, Klinke, USB, HDMI, XLR, Dioden.
Inzwischen etabliert sich aber immer mehr die kabellose Übertragung mit Hilfe digitaler Funkverbindungen (z.B. WiFi, Bluetooth oder selten mit einer proprietären Funktechnik).
-----------
(← Top )

Elektrotechnik:
Für Musikanlagen, die aus mehreren Geräten zusammengestellt sind, da benötigt man mehrere Steckdosen. Dafür gibt es die 230V-Steckerleisten.
M.E ist es empfehlenswert, eine Steckerleiste mit Netzfilter und Blitzschutz zu verwenden. Sinnvoll kann es auch sein eine Steckerleise mit einem Ein-Ausschalter zu verwenden. Dadurch können alle Netzgeräte und Netzteile zentral stromlos geschaltet werden, wenn die Anlage nicht in Gebrauch ist.
Ebenso gibt es Steckerleisten, die mit einer Master/Slave-Funktion ausgestattet sind. Master/Slave bedeutet, eine Steckdose ist der Master und wenn über den Master Strom fließt (weil das verbundene Gerät eingeschaltet wurde, dann werden automatisch alle weiteren Steckdosen auf der Steckerleiste eingeschaltet. Das ist insofern hilfreich, denn somit muss nur das Gerät an der Mastersteckdose eingeschaltet werden (z.B. der Verstärker) und alle anderen Geräte an den Slave-Steckdosen werden automatisch dazugeschaltet;
mehr Infos zu Steckerleisten gibt es im 2. Teil meines "Großen Vinylratgeber": "Schallplatten Hören": klick HIER.
-----------
(← Top )

HiFi:
Stereofonie/Stereo ist die Wiedergabe in Zwei-Kanal-Technik. Deshalb haben die Stereo-Musikanlagen immer ein Lautsprecher-Paar, jeweils ein Lautsprecher für den linken Stereo-Kanal und dann nochmals ein Lautsprecher für den rechten Stereo-Kanal.
Im Tonstudio werden zunächst Aufnahmen gemacht und mit mehreren Mikrofonen aufgezeichnet. Danach wird mit elektronischen Filtern der Soundmix zusammengestellt und das Stereo-Panorama für
die Master-finale Aufnahme (Master) erzeugt.
Das Ziel der Stereofonie ist mit zwei Lautsprechern bei der Wiedergabe eine möglichst räumliche, gestaffelte Wiedergabe (
("Stereo-Panorama") zu erzeugen weitere Details zur Stereofonie gibt es auf Wikipedia: Stereofonie.
Weitere Hintergrund-Informationen und technische Details:
siehe dazu auch "Stereodreieck" und "Stereoanlage".
Eine kleine Geschichte zur Stereofonie von "Fidelity-Online": www.fidelity-online.de/eine-kleine-geschichte-der-stereofonie/
-----------
(← Top )

HiFi:
Mit "Stereoanlage", damit ist umgangssprachlich die HiFi-Musikanlage im privaten Bereich gemeint. Die Erweiterung ist dann noch eine mehrkanalige AV-Musikanlage (AV=Audio/Video) für das Heimkino.
HiFi-Stereoanlagen gibt es in den unterschiedlichsten Konfigurationen bzgl. des Auf- und Ausbaus. Da gibt es Einzelgeräte (All-In-One), die Kompaktanlage oder eine Anlage, die komplett aus einzelnen HiFi-Geräten zusammengestellt wurde.
Das linke Foto zeigt einen typischen Musikanlagen-Konfiguration eines HiFI- Enthusiasten bestehend aus einem Plattenspieler, CD-Player, Streamer-Verstärker und einem Lautsprecher-Paar, inkl. eines Kopfhörers.
Eine Übersicht unterschiedlicher HiFi-Geräte
Streamer, Streaming-Verstärker, Tuner, Receiver, (Voll-)Verstärker, Vorverstärker, Endstufe, Equalizer, Phono-Vorverstärker, Plattenspieler, CD-Player, Kassetten-Deck, DAT-Tape-Deck, Spulen-Tonband, MiniDisc-Player, Lautsprecher, Kopfhörer, Mischpult, Soundkarte, Umschalter, Bluetooth-Sender/Empfänger, Rack und die analoge, digitale oder kabellose Verkabelungstechnik.
Weitere Informationen:
s. dz. "HiFi", "Surround"; auf Wikipedia: Stereoanlage und "Stereofonie"
-----------
(← Top )

Lautsprecher:
Für eine optimale Stereowiedergabe sollte die Hörposition den gleichen Abstand zu den Lautsprechern haben, wie die beiden vorderen Lautsprecher voneinander entfernt sind. Geometrisch betrachtet ist das ein (gleichschenkliges) Dreieck und deshalb nennt man diese Anordnung "Stereodreieck"!
Die optimale Hörposition nennt man im Fachjargon "Sweetspot", denn in dieser Position wirkt das "Stereo-Panorama" am besten. Zusätzlich verbessert man den "Stereoeffekt", wenn man die beiden Lautsprecher um ca. 30° in Richtung der Hörposition anwinkelt (s. Grafik). Kann man die optimale Hörposition nicht verwirklichen, dann kann man ggf. mit dem Balance-Regler am Verstärker einen Ausgleich schaffen, indem man einen Lautsprecher lauter einstellt.
Zusätzlich ist empfehlenswert, dass sich der Kopf und die Lautsprecher in etwa auf gleicher Höhe befinden. Bei kleinen Boxen (z.B. Kompaktboxen, Monitoren oder Regalboxen) kann man die optimale Höhe ggf. mit Lautsprecherständern erreichen.
Weitere Informationen::
- s. dz. "Sweetspot", "Stereo-Panorama" , "Stereophonie", "Bühne"
-----------
(← Top )

Lautsprecher:
Unter "Stereo-Panorama" verstehe man die räumliche Platzierung einzelner Klangquellen (Stimmen, Instrumente) in der "Stereo-Klangbühne". Man könnte m.E. den Begriff "Stereo-Panorama" auch mit "Stereo-Raumklang" oder "Stereo-Klangbild" oder auch mit "Tiefenstaffelung" benennen, wobei in der "Stereo-Panorama" wohl ein Begriff im Fachjargon der Mixer und Toningenieure ist.
Den Vorgang zur Erstellung eines Panoramas wird bei Abmischen mit "Panning" bezeichnet. Um die Positionierung beim Abmischen ("Mixen", "Mixdown") herzustellen, dazu gibt es auf den DAWs (Digitale Audio-Workstation) die PAN-Regler.
Um ein "Stereo-Panorama" hören zu können, Bedarfs es einer guten Stereoanlage und vor allem braucht man gute Lautsprecher-Boxen, sowie eine gute Hörposition (s. dz. "Stereodreieck") oder einen guten Kopfhörer.
Weitere Informationen:
- s. dz. "Stereo/Stereofonie", "Stereodreieck", "Tiefenstaffelung", "Stereo-Anlage", "Lautsprecher-Boxen", "Lautsprecher-Typen"
- Musiker-Portal "delamar.de":
www.delamar.de/mixing/abmischen-kreatives-panning-fuer-deine-mixe-9330/
-----------
(← Top )

Audio:
Keine Frage, Störsignale haben negativen Einfluss auf den Klang und trüben somit das Hörvergnügen. Die Ursachen sind vielfältig, insbesondere bei alter HiFi-Technik.
Alle hörbaren Signalanteile (Verzerrungen, Rauschen, Rumpeln, Knacken, Knistern), die nicht zur Klangquelle gehören und das eigentliche Audiosignal verfälschen, sind Störsignale.
Bei Audio/Phono gibt es unterschiedlichen Faktoren, die Ursache für "Störsignale" sind. Diese Störungen können verursacht werden beispielsweise von der HiFi-Elektronik, sowie durch Einstreuungen von außen (z.B. Hausnetz), von den Lautsprechern oder auch durch eine fehlerhafte Verbindungstechnik (Verkabelung).
"Störsignale" können aber auch durch einen schlechten Zustand des Tonträgers (z.B. bei einer Schallplatte, einem Tonband oder Kassette) verursacht werden.
Folgende Störsignale sind allgemein bekannt:
Bei der Musikanlage (Audio):
"Verzerrungen" (lineare: harmonische, nicht-harmonische Verzerrungen)
"Verzerrungen" (nicht-lineare: Amplituden-und Laufzeit-Verzerrungen)
"Übersprechen", "Einstreuung" bei Kabelverbindungen (kapazitiv, induktiv),
"Netzeinstreuungen" (von der Hausstromversorgung),
"Rauschen" ("siehe Signalrauschabstand", "Klirren"), "Grundrauschen"
"Rumpeln" (bei Plattenspielern)
Tuner
UKW/FM-Empfangs- und Stereosignalrauschen (s. dz. "MPX-Filter")
Magnetband/Bandgeräte
"Rauschen", Bandrauschen, Grundrauschen
Tonträger:
- Schallplatte: Rumpeln, Knacken, Knistern, Rauschen (z.B. durch einen verschmutze, verkratze Schallplatte)
- Magnetband: Bandrauschen, Aussetzer und Verzerrungen (Fehler auf dem Bandmaterial), Halleffekt durch "Übersprechen"
- CD/DAT/Diskette: Aussetzer (z.B. stark verkratzte CD oder Fertigungsfehler, DAT-Bandfehler)
- WEB-Streaming: kurzzeitige Aussetzer bei Störungen im LAN/WAN oder Internet
Weitere Informationen:
- auf Wikipedia: Störsignal
- Ratgeber von der Firma "HiFi-Regler": www.hifi-regler.de/wissenswertes_und_kaufberatung/kabel/brummen.php
- Portal Kabelwissen: www.kabelwissen.de/glossar_stichwortverzeichnis/elektrischen-eigenschaften/storsignal/
- Portal "Stereoguide": Hilfe! Meine Stereoanlage brummt
-----------
(← Top )

HiFi:
Ein "Streamer" (auch als "Network-Player" bezeichnet) im Bereich HiFi/Audio ist ein Gerät oder eine Gerätekomponente, die es ermöglicht, Ton (Sprache, Geräusche, Musik) von digitalen Quellen zu empfangen. "Steamer" sind in der Lage hochauflösende Streams (Musikdateien, z.B. im FLAC/HighRes-Format) wiederzugeben.
Digitale Quellen sind z.B. Musik-Streaming-Dienste im Internet, das WEB-Radio, das Abspielen digitaler Musikdateien (Digitalisate) von einem Servern (lokal oder im Internet). Oder man koppelt ein Smartphone via Bluetooth.
Ältere Musikanlagen können mit einem separaten Streamer-Modul nachgerüstet werden und dazu benötigt man am Verstärker einen freien RCA/Cinch-Eingang. Moderne Verstärker/Receiver können bereits streamen aber es gibt auch hochwertige "Streamer", die über einen eigenen Monitor oder Touchscreen verfügen. Auf dem Monitor werden diverse Informationen (Bilder, Grafiken, Texte) zum aktuellen Stream angezeigt.
Weitere Info-Quellen zum "Streamer":
https://wiim-audio.de/blogs/news/was-ist-ein-streamer-fur-hifi-anlagen
www.hifiklubben.de/inspiration/streaming/streaming-auf-die-anlage-die-ultimative-losung/
-----------
(← Top )

HiFi:
"Streaming" bzw. das "Musik-Streaming" ist "Music on Demand", das moderne Musikhören aus dem Internet. Seit etwa 2011, mit dem Start von Musik-Steaming-Dienst DEEZER und später dann mit SPOTIFY, fing das Streaming an merklich zu boomen. Andere Dienste wie z.B. NAPSTER, waren bis dato nicht in der Lage nennenswerte Umsätze in Deutschland zu genieren.
Heutzutage tummeln sich viele Anbieter auf dem Markt wie z.B. Amazon, Deezer, Spotify, AppleMusic, TINDAL, NAPSTER usw.
Inzwischen gibt es Musik-Streaming-Anbieter, die ihre Musik in höherer Klangqualität anbieten als im MP3-Format, z.B. Tindal, Qobuz aber auch Apple und Amazon haben mittlerweile Musik im sogenannten HighRes-Format.
HighRes bedeutet, dass die Musik-Titel mit 24 Bit statt wie bisher in 16 Bit gestreamt werden kann und damit eine besser Klangqualität bietet als im Vergleich zu einer Compact Disc (CD). Die technischen Daten von HighRes liegen bei max. 24 Bit mit einer maximalen Sampling-Rate von 192 kHz (HighRes-FLAC).
Die neuste Trend ist, dass einige Streaming-Dienste die Musik auch in Dolby-Atmos bereitstellen.
Hier die Reportdaten aus 2024 zum Streaming von der Deutschen Musikindustrie (Quelle BVMI):
Streaming hat um 12,1% zugelegt und hat mittlerweile einen Anteil von 84,1% am Gesamtumsatz erreicht.
Der Marktanteil an physischen Datenträger hat nur noch 15,9% (davon die CD 8,7% und die Vinylschallplatte hat 6,4%)
Pressebericht des BVMI zu Jahresumsatz im Jahr 2024: klick HIER
Meine Einschätzung zur zukünftigen Entwicklung:
Das Streaming wird die physischen Tonträger-Markt immer weiter zurückdrängen. Lediglich in einer kleinen Markt-Nische wird es eine Fan-Base geben, die weiterhin aus nostalgischen Gründen, die
veralteten Tonträger kaufen und sammeln werden. Weit über 50% der Musikkonsumenten streamen inzwischen; bei den 14- bis 29-Jährigen waren es sogar 84%
(Stand 2022)
Weitere Informationen:
- auf Wikipedia: "Geschichte und Entwicklung des Streaming"
- Pressebericht vom 16.01.2025 des BVMI zur Entwicklung des Musikstreaming in 2024: klick HIER
-----------
(← Top )

HiFi:
Der jüngste Spross in der Familie der HiFi-Bausteine ist der "Streaming-Verstärker".
Durch die Musik-Steaming-Angebote im WEB, insbesondere durch das HighRes-Streaming (s. dz. "Musikstreaming" und "HighRes"), hat sich inzwischen auch das Streaming im HiFi-Bereich als weitere Audioquelle durchgesetzt.
Da es in jüngster Zeit den Trend gibt, die heimische Musikanlage wieder eher kompakt aufzubauen, anstatt aus vielen einzelnen Komponenten zusammenzustellen, kommen jetzt als Alternative mehr und mehr "Streaming-Verstärker" auf den Markt. Ein "Steaming-Verstärker" ist im Konzept vergleichbar mit einem Stereo-Receiver, jedoch statt dem Radioempfänger ist der "Streamer-Verstärker " (inkl. Display und Bedienungs-App) der Hauptbestandteil der modernen digitalen Musikanlage. Man benötigt lediglich dazu noch die Lautsprecher-Boxen und damit ist die Musikanlage eigentlich komplett. Die Analog-Fans widersprechen sicherlich dieser Aussage.
-----------
(← Top )

Plattenspieler:
Ein Stroboskop/Stroboskoplicht am Plattenspieler dient zur optischen Drehzahl-Kontrolle des rotierenden Plattentellers. Daher haben viele (nicht alle) Plattenteller seitlich am Rand unterschiedliche Markierungen und wenn diese Felder sich in Richtung zur Rotation des Plattentellers bewegen oder in die entgegengesetzte Richtung, dann hat man eine Drehzahlabweichung. Ist das der Fall, dann sollte man die Drehzahl korrigieren.
Das Stroboskoplicht hat eine Lichtfrequenz, die so justiert ist, dass genau bei der Nenndrehzahl des Plattentellers von 33 1/3 Umdrehungen/Minute oder 45 Umdrehungen/Minute die Markierungen am Plattentellerrand stillstehen. Sollte das nicht der Fall sein, dann kann man mit dem Drehzahlregler (s. dz. "Pitch Adjustment/Pitch Control") die Drehzahl korrigieren.
Tipps:
Hat der Plattenteller keine Drehzahlkontrolle, dann kann man alternativ eine Stroboskopscheibe/Kalibrierscheibe auf den Plattenteller legen.
Man kann eine Überprüfung der Drehzahl auch mit einer Smartphone-App machen (z.B. die App "RPM Speed & Wow" oder die App "Turntable Speed")!
-----------
(← Top )

Elektrotechnik:
Jedes elektrische Gerät in einem Haushalt verbracht Strom, sobald es in Betrieb genommen wird.
So ist es auch im Betrieb einer HiFi-Stereo-Anlage. Der Stromverbrauch hängt von der gesamten Wattzahl aller HiFi-Bausteine ab.
Wen es interessiert, der kann den Verbrauch beispielsweise mal mit einem mobilen Stromzähler ausmessen. Es gibt kleine Strommessgeräte, das sind Steckdosen-Adapter, die zwischen Netzstecker und der Steckdose zwischengeschaltet werden. Damit kann der aktuelle Stromverbrauch als auch eine Langzeitmessung durchgeführt werden.
Mein Tipp:
Ich benutze eine schaltbare Steckerleiste mit der ich alle Geräte der Anlage ein- und ausschalten kann.
Nützlich aber nicht unbedingt notwendig: meine Steckerleiste hat zusätzlich einen eingebauten Blitzschutz und einen Stromfilter.
-----------
(← Top )

Lautsprecher:
Es gibt Fans des "Subwoofers", es gibt aber auch HiFi-Liebhaber, die den Subwoofer kategorisch ablehnen.
Der Subwoofer ist ein Basslautsprecher, der speziell für die sehr tiefen Frequenzen ausgelegt ist. Das Lautsprecher-Chassis ist ein Tieftöner mit einer großen Membran, das in einem separaten Gehäuse (s. dz."Bassreflexgehäuse") eingebaut ist und mit einer Subwoofer-Verstärker-Elektronik ausgestattet ist. Es gibt aber auch Subwoofer ohne Elektronik, das ist dann ein passiver Subwoofer. Mit der Verstärker-Elektronik des Subwoofers wird der Pegel ("Lautstärke"), die "Trennfrequenz" und die "Phasenlage" eingestellt.
Üblicherweise sind Verstärker und Receiver mit einem separaten Subwoofer-Ausgang ausgestattet, an dem der Subwoofer, via RCA/Cinch-Verbindung, angeschlossen wird. Sollte der Verstärker keinen Subwoofer-Ausgang besitzen, dann kann man alternativ eine separate Subwoofer-Frequenzweiche verwenden.
Es gibt Subwoofer-Modelle, die direkte nach vorne abstrahlen und es gibt auch Modelle, die zum Boden abstrahlen, die sogenannten "Downfire-Subwoofer". Auf jeden Fall ist empfehlenswert, den Subwoofer vom Boden zu entkoppeln, beispielsweise mit Spikes oder Absorberfüßen.
Mehr Informationen zum "Subwoofer" gibt es beispielsweise beim HiFi-Hersteller Sonos: "Bass für Einsteiger" und/oder auf Wikipedia: Subwoofer.
-----------
(← Top )

HiFi:
Der Einstieg in die "Surround-Systemtechnik" (Raumklang) war eigentlich die "Kunstkopf-Stereofonie" in den 70er Jahren. Es wurden zwei Mikrofonen in einem künstlichen Kopf eingesetzt (die Mikrofone wurden in Ohrnachbildungen integriert) und dadurch versuchte man den menschlichen Höreindruck nachzubilden. So war es möglich Klang zu erzeugen, der von hinten ertönte. Das funktioniert einigermaßen gut (jedoch mit leichten Schwächen) und man musste dabei einen Kopfhörer benutzen. Aktuell wird die Kunstkopfstereofonie in ähnlicher Technik (2 Mikrofone aber ohne Kunstkopf) als sogenannte "binaurale Aufnahmetechnik" fortgeführt.
Der direkte Nachfolger der "Kunstkopf-Stereofonie" war dann die "Quadrofonie". Hier wurde bereits im Tonstudio die Musik anstatt wie bisher üblich in zwei (Stereo-)Kanäle aufgeteilt, sondern hier wurde nun die Musik in vier separate Kanäle aufgeteilt, d.h. 2x Front und 2x Back, sozusagen ein "Doppel-Stereo". Dadurch entstand der erste wirkliche Raumklang. Dazu waren aber 4 Lautsprecher-Boxen notwendig.
Dieses Prinzip wurde dann durch "THX" und "dts" für das Kino entwickelt. Wobei hier 2 weitere Kanäle hinzukamen, jeweils für die Seitenwand links und rechts und dazu noch ein "Center-Speaker". Ergänzt wurde der neue Klangraum mit einem Subwoofer.
Die aktuellste Surround-Klangtechnik ist das "Dolby ATMOS" und "dts:x". Bei "Dolby-Atmos" werden dreidimensional einzelne Objekten (egal ob fest oder bewegend) elektronisch als Klangquelle dargestellt. Beispiel-Szenario: ein Hubschrauber taucht weit vorne flach von rechts auf, steigt höher und höher, fliegt quer oben drüber und verschwindet allmählich nach links hinten. Parallel dazu gibt es weitere, lokalisierbare Klangquellen mit entsprechender Tiefenstaffelung.
Das funktioniert ab nur gut, wenn das Lautsprecher-System auch Lautsprecher beinhaltet, die nach oben abstrahlen (s. dz. im Foto die vorderen Lautsprecherboxen. Dort sind 2 zusätzlich Lautsprecher-Boxen platziert, die direkt in Richtung Decke abstrahlen).
-----------
(← Top )

Audio:
Der Begriff "Sweetspot" beschreibt nicht beliebte Körperstellen (😁), sondern den optimalen Platz, wo man im Raum den besten "Klang" ("Klangbild") hat bzw. das "Stereo-Panorama" am besten hören kann.
Mehr dazu im Begriff "Stereodreieck".
-----------
(← Top )
(Ende)




